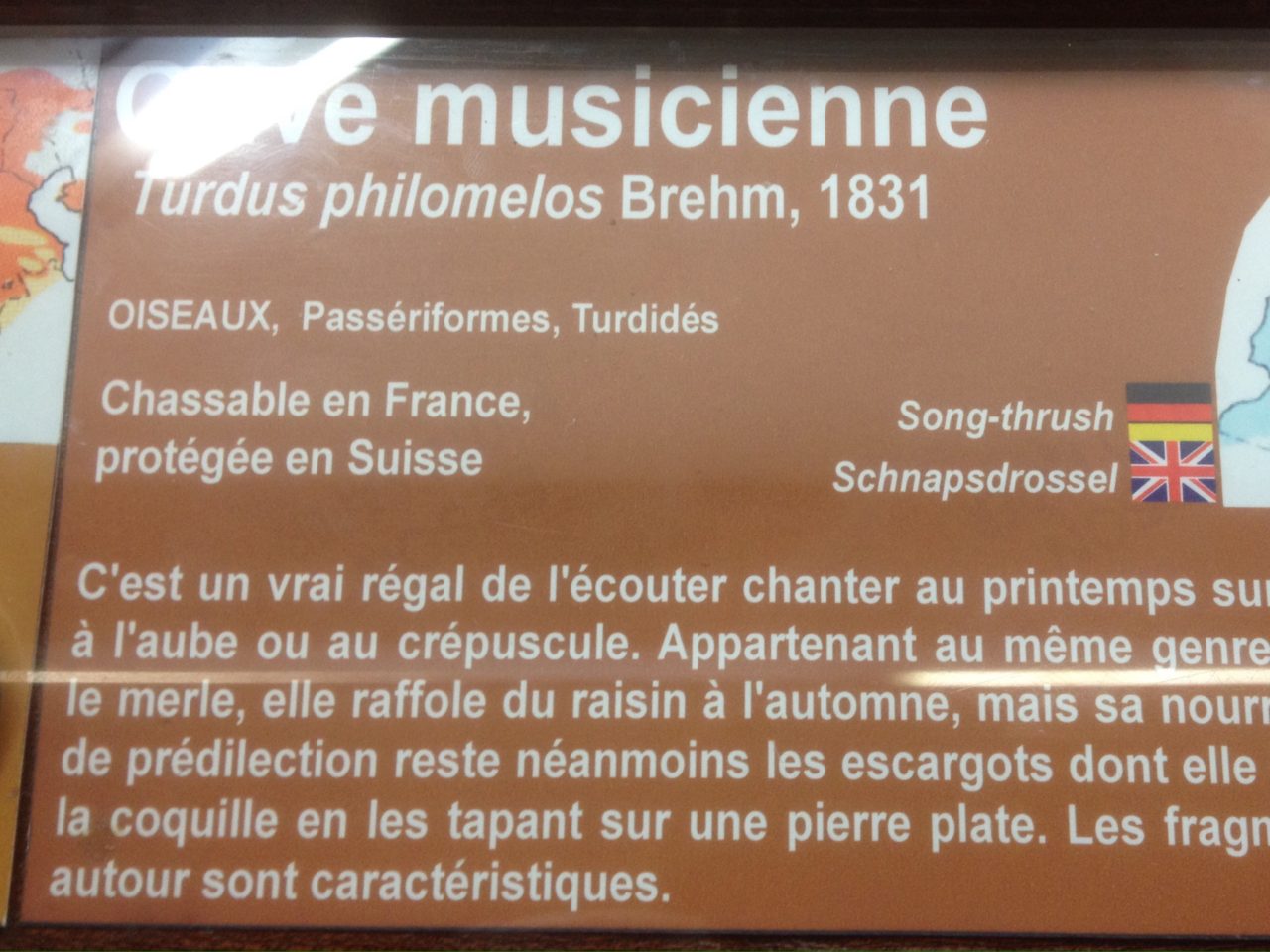28.04
Mein Reiseführer erzählt mir, dass die Gegend der Auvernge von den Vasconen besiedelt worden sei, Basken, deren seltsame Sprache noch in den Ortsnamen ablesbar ist, die oftmals auf -ac
enden, wie Cognac. Niemand weiß, zu welcher Sprachfamilie das Baskische gehört. Das erinnert mich daran, dass ich dieses Rätsel auch noch lösen muss, nachdem ich den Diskus von Phaistos und das Voynich-Manuskript entziffert, sowie die Herkunft des Etruskischen erklärt habe. Dann muss ich nur noch die Quadratur des Kreise schaffen. Bloß wie kriegt man die verdammten Ecken weg? Mit Photoshop vielleicht?
Der Heilige Rochus wird in Sangues verehrt, der Schutzheilige der Pestkranken und Helfer bei offenen Wunden, ich muss an meinen alten Tübinger Stammtisch Freund denken.
Sollte für die ganzen Schutzheiligen des Pilgerns, den großen Ibupropheten, als da wären der heilige Immodium, Voltarenus, Compeedius mehrere Carmina dichten. Hier ist das erste:
O Heiliger Voltarenus,
Gelobt sei dein kühlendes Gel
Der Du linderst unsere Schmerzen
Du bist unser Hoffen und unser Sehnen
kühlendes Mittel!
Gesalbt seist Du auf unsere Beine
dass sie auferstehn am Morgen
Und uns tragen am Tage
Bis wir am Abend in unserer Herberge
Dich wieder loben und preisen
und schmieren an jeglichem Tage
bis ans Ende unseres Wegs.
Ich biege ins Loire-Tal ab, weniger Höhenmeter und ein Fluss, der schwarzes Wasser zwischen Felsen, Kiesbänke und Weiden sprudelt lässt. Hier Kanufahren muss ein Traum sein. In Camelieres sur Loire zieht mich eine mächtig gebaute Kirche von der Straße. Ein riesiger romanischer Kapellenumgang, alles in wuchtigem graubraunem Stein gefügt, mit weißen Mörtelfugen. Sie wirkt wie eine Grotte, an der Wand hängen noch bemalte Trümmer eines romanischen Altars. Bete. Schiebe müde und erschöpft durch die steinerne Altstadt das Fahrrad zur Straße neben einem krummen alten Mann, der seine eben so alte Motoregge als Rollator benutzt. Altern auf dem Dorf.

In der Kirche habe ich für ein weniger anstrengendes Reisen gebetet. 500 Meter später werden meine Gebete erhört. Der Herr schickt mir einen Platten, weil er genau weiß, dass ich weder Werkzeug noch sonst was mithabe. Etwa vier Minuten später kommt ein Taxi vorbei und nimmt mich auf dem Rückweg mit nach Le Puy en Velay.
Der Taxifahrer hat einen gesunden Mutterwitz: Ob ich keine Pumpe dabei hätte, fragt er mich, „das schon“, erwidere ich, mir würde der 15er fehlen für die Radmuttern. „Es fehlt immer etwas“, meint er trocken.

Le-Puy-en-Velay scheint mit einem Hubschrauber auf drei spitze Kegel gesenkt: Auf einem prangt eine kirchturmhohe Marienstatue, auf dem anderen reckt sich eine Kirchenburg und auf dem dritten klebt die Altstadt.
Dort ist auch das Refugium, in dem man erst mal Minzsirup, Wasser und einen Keks bekommt. Weil das Einchecken dauert. Warum hält man eigentlich immer den, der am meisten quasselt für den Chef? Ein Mann viereckig, graubraun, wenige schlechte Zähne, redet und redet. Er ertrinkt in seinem Gerede, und redet dabei wild um sich, so als würde glauben, nur noch durch noch mehr Reden, könnte er sich retten. Eine halbe Stunde textet er mich zu und endet damit: „Und nachher erkläre ich Ihnen alles.“ Ich fliehe in den Decathlon und lasse mein Radel reparieren.
Ärgerlich, der Busfahrer nimmt mich wegen des Fahrrads nicht mit, aber wie soll man sonst zu einer Fahrradwerkstatt kommen, wenn man kein Auto hat??? Ein dicker Taxifahrer macht die Fuhre.
Ich kaufe ein und das Baguette erinnert mich daran, dass ich auch noch das Rätsel lösen muss, warum in Frankreich die Papiertüten immer so kurz sind, dass die Baguette oben rausgucken?
29.04
Le-Puy – Sauges

Morgens ist Pilgermesse um sieben. Etwa 30 Pilger sind da, sogar welche aus Neuseeland und Mexiko. Sehr ergreifend und sehr rührend, ich muss aufpassen, dass ich nicht in religiöse Verzückung gerate. Eigentlich wollte ich in Le Puy bleiben, aber bin wohl in den letzten Wochen etwas menschenscheu geworden. Der Rummel geht mir auf den Wecker.
Der Priester bezeichnet das Pilgern als Gottesdienst mit den Füßen, und man könne im Wandern in der Stille und in der Natur Gott suchen, und ihn vor allem in seiner Schöpfung finden. Tatsächlich ist die Natur für mich der evidenteste Hinweis auf die Existenz Gottes. Erinnert mich an einen Witz, den mein Chemielehrer machte. Wie kann man mit Darwinismus die Schwerkraft erklären? Na am Anfang gab es Steine, die flogen nach oben, nach rechts und nach links, und manche nach unten. Die nach oben und zur Seite flogen, sind weggeflogen, und die Steine nach unten sind geblieben.

Zu glauben, die Natur sei allein durch Zufall entstanden, ist genauso intelligent wie zu glauben, ein Flugzeug wäre durch Zufall entstanden, auch wenn es nach oben und zur Seite fliegen kann und sogar nach unten. Die Frage wäre auch, ob die Existenz eines Ich von einem Du abhängig ist, weil nur das Andere die Grenzen von uns selbst zu ziehen vermag, insofern könnte man Gott auch als das extrapersonnelle Du anschauen, das notwendig ist für mein Ich. Bevor ich mich weiter auf philosophische Höhen versteige, geht ich erstmal die 1100 Meter im Hochland der Margeride an.
Noch drei Beobachtungen vor dem Anstieg:
1) Ob Gott existiert, hängt also im Grunde von der Frage ab, ob es einen Zufall gibt oder nicht.
2) Da Kirchen meistens nach Osten ausgerichtet sind, bieten sie einen zuverlässigen Wegweiser für die Himmelsrichtungen in Städten und Dörfern.
3) Die haben hier in der Auvergne einen verteufelt guten Rosé.
Radele durch flaches Hochland und tiefe Täler, in ihrer Schönheit kaum beschreiblich, der liebe Gott hat große Granitblöcke über tiefgrüne Weiden gemurmelt, bestanden mit Kiefern und Schlehen. In meiner Phantasie setzten sich die Granitfindlinge zu Überresten von Steinzeitgräbern zusammen, zu neolithischen Sonnenuhren, zu uralten Verteidigungswällen.
Die Schlehen treiben aus. Kaum eine Pflanze hat ein derart krüppeliges und brutales Aussehen und gleichzeitig so zarte weiße Blüten. In den Felsen kauern Steinpflanzen, die ich noch nie gesehen haben, Fleckvieh grast und Kaltblutpferde sind auf den Weiden mit Klodeckel-großen Hufen.

Sauges: Dort wo der letzte französische Werwolf wütete. Eine hölzerne Beste fletscht das Gebiss ins Tal, zum Andenken an ein Tier, das ein französischen Jäger 1764 mit einer Silberkugel erschoss und das zuvor an die 100 Frauen und Kinder umgebracht hatte. Hatte mal eine Dokumentation über die Bestie von Sauges gesehen. Danach muss es eine Tüpfelhyäne gewesen sein, die wohl aus einem Zirkus ausgebrochen war. Leider ist das Bestien-Museum geschlossen, also lieber Rosé trinken.
30.04
Sauges – St. Alban
Einsam kam ich aus Wäldern und Städten, Schluchten hüllten mich ein und Wind.
Und jetzt: An jeder Ecke wird wild drauflos gepilgert. Die Via Podiensis ist eine Touristenattraktion, die Dorfstraßen sind von Pilgerkneipen flankiert, Jakobusstatuen weisen den Weg, die Kneipen sind bevölkert von jenen Pilgern, die schon ein Weilchen unterwegs sind, und die man an den wetterbraunen Gesichtern und den ent- bis verrückten Augen erkennt, daneben die tatendurstigen Neupilger, die in Le Puy angefangen haben, und die mit viel zu großen Erwartungen an ihre Kräfte losstürmen, die aus meiner Sicht jetzt eitel oder kindisch wirken, bloß: so war ich ja auch. Der Weg wird auch sie belehren.
Und Du aWeg, was machst Du? Odi et amo, schon allein für diesen schönsten Vers der Welt lohnt es sich, ein wenig Latein zu treiben. Auf dem Weg nach St. Alban hält ein Bauer, der mich müden Mann das Fahrrad schieben sieht. Fragt ob, ich Hilfe brauche, nein, ich sei nur müde, wirklich nicht, nein. Er dreht um, er ist extra hinter mir hergefahren
Südliche Steine, aber nördlicher Himmel: Tropfen perlen herab von wilden Narzissen, Ginster und Schwarzkiefern, später unbarmherziger Regen, der Himmel eisern, dann Schnee, wattige Flocken. Ich spiele wieder Kinderspiele, kneife die Augen zusammen und fühle mich wie Kapitän Kirk auf der Enterprise, die weißen Flocken sind die Sterne, die an meinem Raumschiff vorbei fliegen. Dann wird es ernst, ich bin für Radfahren bei Schnee nicht ausgerüstet, Jacke und Hose sind durchnässt, heftiger Gegenwind jetzt, in Bewegung bleiben, nicht absteigen, in Bewegung bleiben, bloß nicht frieren, nicht absteigen, meine Jacke hat sich weiß gefärbt, die Hände sind taub und so kalt, dass der Schnee drauf liegen bleibt. 
Ich muss das nächste Dorf erreiche, dort will ich jemand rausklingeln und bitten, dass er mich in die Stube lässt, um mich aufzuwärmen. Kämpfe mich Meter für Meter vorwärts, sehe im Schneegestöber ein Schild: „Bar“.
Meine Rettungsinsel ist mäßig bevölkert. Um den Tresen sitzen fünf Leute aus dem Dorf. Von ihren Gummistiefeln fällt Stallmist auf den Boden, sie diskutieren über Politik, ich verstehe nur Etrangeres, eine jüngere Frau hält dagegen, redet von Marschall Petain und Bomben auf Leute und verlässt dann wutentbrannt die Kneipe.
Es gibt für fünf Euro große Rindfleischbrocken mit Oliven und Spaghetti mit dunkler Soße und gelben Rüben, serviert auf gesprungenen und zerwaschenen Tellern.
Im wahrsten Sinne kommen immer mehr Pilger reingeschneit, die Unterhaltung mit zwei Bretonen vergrößern meinen Wortschatz. Ob sie noch Bretonisch können? Nein, höre ich, nur noch die Großväter. Ich rede davon, dass für mich das Sterben einer Sprache mit zum Schrecklichsten gehört, weil es ein Sterben einschließt von Metaphern und Weltsicht, der ganzen Weisheit eines Volkes. Es gebe Hoffnung, sagt er, wir haben jetzt sogar eine bretonische Schule für die Jungen. Die Pilgertruppe ist mit gutem Humor ausgestattet und so essen wir und trinken, bis die Sonne scheint und wir weiterkönnen. Zwei Holländerinnen beeindrucke ich, als ich meine Jacke auswringe, die literweise Schmelzwasser spuckt.
Lange ein Wiesel bei Tiefbauarbeiten beobachtet. Ich schiebe das Klapprad auf 1300 Meter, in einen weiteren harten Schneeschauer, kleine gemeine Graupel, die verletzten. Komme heil den Pass runter, „pfifft“, mache ich, ging doch und „pfifft“ macht mein Reifen, geht nicht mehr.
Die gütige Herbergsmutter, hat einen 15er. Aus dem Reifen operiere ich zwei Glassplitter und ein Metallstück. Dann Abendessen in einer kleinen familiären Unterkunft. Suppe gut, alles gut.